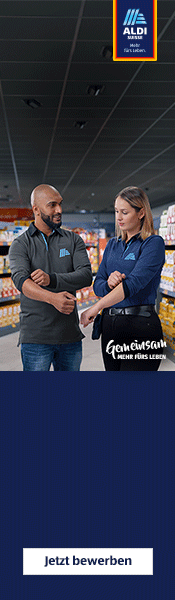Erfolg hat, wen der Interviewer mag
Nicht Kompetenzen oder Kontakte entscheiden, wer den Job bekommt. Der Bewerber muss nur dem Personaler oder Chef sympathisch sein, sagt die Soziologin Lauren
Rivera.

Frage: Sie untersuchen die Verhaltensmuster und Erfolgsstrategien in Vorstellungsgesprächen. Haben Sie selbst je eines erlebt?
Lauren Rivera: Ja klar! Als Schülerin habe ich ständig gejobbt. Nach dem College habe ich als Unternehmensberaterin gearbeitet, vorher hatte ich mich bei einer Investmentbank
beworben. Ich erinnere mich an das erste Gespräch dort sehr genau. Die erste Frage lautete: Schlafen Sie gerne? Was für eine unsinnige Frage, dachte ich damals. Natürlich habe ich mit Nein
geantwortet. Heute weiß ich: Die Frage passt ins Muster.
Frage: Welches Muster?
Rivera: Ich habe insgesamt bei ungefähr 120 Interviews mit am Tisch gesessen, zudem mit Hunderten Interviewern direkt nach den Gesprächsrunden geredet, die für die großen
Kanzleien, Investmentbanken und Beratungen Mitarbeiter auswählen. Das sind die drei Branchen, über die Elitenrekrutierung in den USA fast ausschließlich läuft. Eine der ersten überraschenden
Erkenntnisse dabei war: Der scheinbar belanglose Small Talk, der am Anfang des Gesprächs stattfindet und sich oft um Sport und Hobbys dreht, ist viel wichtiger als die meisten
denken.
Frage: Das gilt für alle Vorstellungsgespräche?
Rivera: Nein. Interessanterweise habe ich festgestellt, dass der Anteil fachlicher Fragen abnimmt, je elitärer der Job ist, um den es geht. Als Jugendlicher habe ich ständig
irgendwo gejobbt, zum Beispiel in Cafés. Einmal habe ich mich als Barista beworben, da musste ich demonstrieren, wie ich mit einem Kunden umgehen würde. Bei den hoch dotierten Einstiegsjobs im
Investmentbanking oder insbesondere bei den großen Kanzleien geht es viel mehr um Belanglosigkeiten. Und die bestimmen oft, wie die Stimmung des gesamten Gesprächs ist – und das gibt dann häufig
den Ausschlag.
Frage: Warum tun Unternehmen das?
Rivera: Es handelt sich meistens nicht um eine offizielle Vorgabe des Unternehmens. In diesen Spitzenjobs sind es ja oft keine Personaler, sondern die Berater, Banker und Anwälte
selbst, die Mitarbeiter auswählen. Da schaut man nicht auf formale Kompetenzen, sondern auf die Persönlichkeit des Bewerbers.
Frage: Das heißt aber auch: Die Interviewer haben kein großes Wissen darüber, wie man Personal effizient auswählt.
Rivera: Na ja, sie würden das so natürlich nicht sagen. Oft ist mir der Ausspruch smart people make smart choices begegnet. So sehen sich in diesen Branchen viele. Weil sie
selbst kompetent in dem Feld sind, in dem der Kandidat später arbeiten soll, wissen sie auch am besten, wie man gute Kandidaten erkennt.
Frage: Und, klappt das?
Rivera: Auch das hängt davon ab, wen Sie fragen. Die Interviewer mit denen ich gesprochen haben, waren meistens ziemlich überzeugt davon, dass ihr System funktioniert. Manche
aber haben sich auch selbstkritisch geäußert und zum Beispiel darauf hingewiesen, dass sie sich manchmal von Kleinigkeiten einnehmen oder abschrecken lassen, die vielleicht gar nicht so
entscheidend sind.
Frage: Zum Beispiel?
Rivera: Oft ist es eine sportliche Vorliebe, die sie mit dem Bewerber teilen. Je abseitiger, umso besser. Mit einem Interviewer habe ich direkt nach einem Bewerbungsgespräch
gesprochen, der Lacrosse spielte, genau wie der Bewerber selbst. Das hatte ihn total begeistert, sie sprachen lange über den Sport. Danach war der Interviewer fast ein bisschen paralysiert: Was
ihn inhaltlich so an dem Kandidaten fasziniert hatte, konnte er kaum noch sagen. Der Interviewer muss den Kandidaten mögen, das Gefühl haben, dass er gerne mehr Zeit mit ihm verbringen würde. Und
dieses Gefühl entsteht vor allem durch sprachliche Signale, die auf einen gemeinsamen kulturellen Hintergrund schließen lassen. Sport ist dabei nur ein besonders plakatives Beispiel.
Frage: Am Ende entscheidet also eine große Portion Zufall über den Erfolg eines Bewerbers.
Rivera: Das kann eine Rolle spielen. Vor allem aber geht es nicht darum, einzelne Fragen richtig oder falsch zu beantworten. Sondern um den allgemeinen Eindruck, der hängen
bleibt. Grundsätzlich bestehen die meisten Vorstellungsgespräche aus drei Phasen: Am Anfang Small Talk, dann wird über die Vita des Kandidaten gesprochen, zum Schluss kommen fachliche Fragen. Die
Interviewer beziehen sich in ihrem Gesamturteil aber selten auf diese großen Blöcke. Gerade bei den Gesprächen, die ich mit Bankern und Anwälten geführt habe, waren es meistens Kleinigkeiten aus
dem anfänglichen Small Talk, die das gesamte Gespräch prägten.
Frage: Aber wie soll man sich denn auf diesen Small Talk vorbereiten?
Rivera: Das kann man nicht pauken. Die Muster, die sich hier zeigen, zielen eher auf das dahinterstehende Milieu ab, wissenschaftlich nennen wir das cultural fit. Zwar mögen
Sportarten wie Lacrosse erst mal abseitig scheinen, sie sind aber – zumindest in den USA – in elitären Kreisen sehr verbreitet. Das Gleiche gilt für die sozialen Aktivitäten und die kulturellen
Interessen, die besonders häufig auf Zustimmung stoßen.
Frage: Letztlich sucht die Elite hier also wieder Menschen aus ihrer Mitte aus?
Rivera: Darauf läuft es hinaus. Aber das heißt nicht, dass das ein völlig geschlossener Verein ist. So spielten zum Beispiel persönliche Beziehungen zwischen dem Kandidaten und
dem Personalverantwortlichen in den Gesprächen, die ich geführt habe, kaum eine Rolle. Die Vorauswahl war in dieser Hinsicht gerade an den Eliteuniversitäten schon sehr transparent. Nur bei
Kandidaten, die von anderen Universitäten kamen, spielten persönliche Verbindungen eine Rolle. Auch ohne das richtige Elternhaus kann man also in diesen Elitezirkel vorstoßen. Wer das aber
wirklich will, der muss schon während der Uni sein soziales Leben bewusst auf die richtigen Kreise ausrichten. Wer nebenbei arbeiten muss, um sein Studium zu finanzieren, wird das natürlich kaum
schaffen.
Frage: Man müsste sich also bewusst in ein bestimmtes soziales Milieu "einschleichen".
Rivera: Das wäre die sicherste Variante. Sprache und andere soziale Codes, all das kann man lernen. Aber es kostet sehr viel Zeit, und es gelingt am ehesten über persönliche
Kontakte. Wer darauf keinen Zugriff hat, der muss sich mit kleineren Kniffen behelfen, die man mit ein bisschen Fingerspitzengefühl hinbekommt. So habe ich immer wieder von Interviewern gehört,
dass sie sich bei der Auswahl von Kandidaten letztlich an sich selbst als Ideal orientieren.
Frage: Das heißt, als Kandidat sollte man das Gegenüber imitieren?
Rivera: Das ist natürlich überspitzt ausgedrückt. Aber es ist zweifellos sinnvoll, Ähnlichkeiten bewusst hervorzuheben, wenn sie einem auffallen. So haben zum Beispiel viele der
Manager aus dem Investmentbanking und der Beratung ein immenses Selbstvertrauen. Das sollte auch der Kandidat ausstrahlen.
Frage: Wirkt das nicht schnell überheblich?
Rivera: Es geht darum, dem Gegenüber das Gefühl zu vermitteln, dass man sich Großes zutraut – ohne die Autorität seines potenziellen Vorgesetzten infrage zu stellen. Nach
dem Motto: Wenn ich groß bin, dann möchte ich werden wie Sie. Man müsste das noch ergänzen um den Zusatz: Und man merkt mir auch an, dass ich das schaffen kann.
Frage: Was für ein Schlag von Menschen ist es denn, die solche Jobs am Ende bekommen?
Rivera: Wir müssen uns klarmachen, dass, zumindest in den USA, über diese drei Branchen die absolute Elite der Wirtschaft ausgewählt wird. Die Einstiegsgehälter liegen um mehr
als das Doppelte über denen in anderen Branchen. Wer da reinkommt, der spielt in einer anderen Liga, die der Rest nie mehr erreicht. Mehr als die Hälfte aller Absolventen bewerben sich für die
Jobs in diesen Branchen. Höchstens fünf Prozent der Bewerber kommen durch. Wer es schafft, der trägt von da an die tiefe Überzeugung in sich, dass er es sich durch eigene Leistung verdient hat,
in diesen Kreis vorzustoßen. Dabei zeigen meine Studien, dass es zu einem entscheidenden Teil doch vom sozialen Milieu der Herkunft abhängt, nicht von der Leistung.
Frage: Die Auswahl in der Marktwirtschaft nach dem Leistungsprinzip ist also eine Illusion?
Rivera: So weit würde ich nicht gehen. Denn wer in diesen Gesprächen erfolgreich ist, der bringt immer gute Qualifikationen und ein überdurchschnittliches Maß an Intelligenz mit.
Nur die Annahme, dass hier die Besten der Besten ausgewählt werden, trifft eben nicht zu. An diesem entscheidenden Punkt, der zwischen einem Leben in der oberen Mittelklasse und in der absoluten
Elite entscheidet, sind andere Faktoren ausschlaggebend, die sich vor allem aus dem sozialen Hintergrund ableiten. Aber das passt absolut nicht zum Leistungsprinzip, das gerade für das
amerikanische Selbstverständnis der Wirtschaft von so zentraler Bedeutung ist. Deshalb wird an dieser Stelle die Illusion der Objektivität aufrechterhalten.
Interview: Konrad Fischer
Lauren Rivera:
von der Kellogg School of Management arbeitete zunächst selbst bei einer Personalberatung, danach hat sie über mehrere Jahre als Wissenschaftlerin Personalverantwortliche von Top-Unternehmen
befragt und in Bewerbungsgesprächen mit Uni-Absolventen beobachtet.
zeit.de,